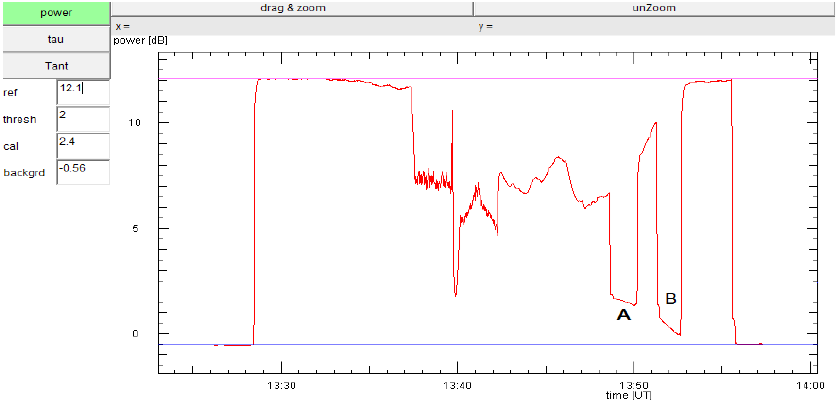
|
Der 27. Juli 2015 war ein Tag mit einem ständig irgendwie bedecktem Himmel, aber ich brauchte einige
Positionsmessungen am 24 GHz Spiegel, und begann die Sonne nachzuführen. Die Rohdaten zeigt
die Grafik: Das Sonnensignal schien zunächst stabil und hinreichend gut zu sein. Um UT 13:38 begann ich
eine Messung der wahren Sonnenposition, obwohl das Signal leicht abfiel. Aber als das Signal noch
viel stärker einbrach, gab ich um UT 13:42 einfach auf ...
Bis dahin war das Signals um mehr als 4.3 dB unter das Normalniveau gefallen. Es war klar, dass
gerade eine große und feuchte Wolke vorbeizog.
Die Schwäche des Sonnensignals würde ein Maß für die optische Dicke der Wolke geben. Daher
schwenkte ich die Antenne zweimal, bei A and B, um etwa 5° ostwärts von der Sonne weg, um
dort die Wärmestrahlung der Wolke zu messen.
Man beachte, dass vor und nach diesem Ereignis das Sonnensignal auf dem gleichen Wert
von 12.1 dB war (angedeutet durch die lila Linie). Gleichermaßen ergab das Himmelsrauschen
- einige Grad östlich der Sonne - denselben Untergrundswert von -0.56 dB (blaue Linie).
Daher können wir getrost davon ausgehen, dass diese beiden Parameter sich während der
ganzen Zeit konstant blieben, und dass der Vorübergang der Wolke nur ein relativ kurzes
einzelnes Ereignis war.
|